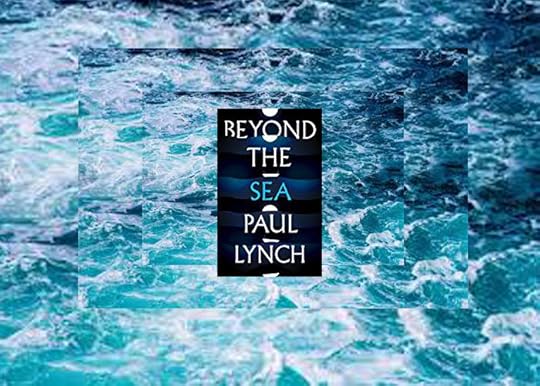What do you think?
Rate this book


Coming to terms with their new reality, they are forced to accept their separation from the modern world, their sudden and inescapable intimacy, and the possibilities and limits of faith, hope, and survival. As the days go by, they grapple with the mistakes of their pasts, the severity of their present, and the uncertainty of their future. And though Bolivar and Hector fight to maintain their will to live, nothing in the barren seascape or in their minds promises that they will make it.
Ambitious and profoundly moving, Beyond the Sea explores what it means to be a man, a friend, and a sinner in a fallen world. With evocative prose, Lynch crafts a suspenseful drama that refuses sentimentality or easy answers. Instead, Beyond the Sea is a hard-won and intimate rendering of the extremities of human life, both physical and mental.
192 pages, Kindle Edition
First published August 29, 2019