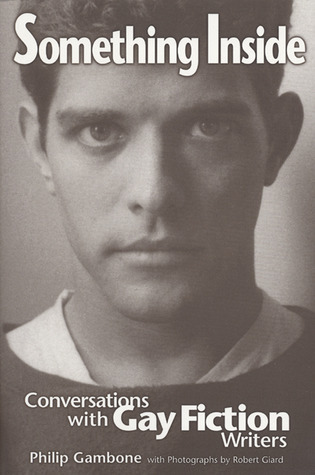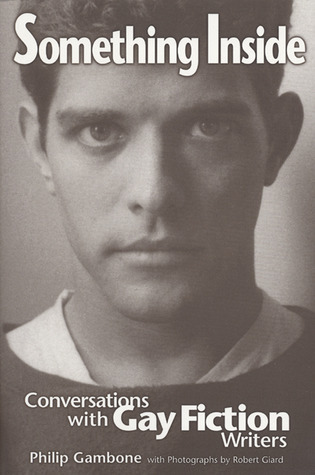21 Interviews mit bekannten Autoren der amerikanischen Schwulenliteratur des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Dieses Buch war schlicht schön. Eins dieser übergroßen Taschenbücher, aber mit gutem, alterungsbeständigem Papier, übersichtlich, leicht lesbarer Satz, dazu schöne Porträtfotos von 16 der 21 befragten schwulen Schriftsteller (Fotograf: Robert Giard).
Allerdings ist das Buch wegen den mittlerweile verstrichenen Jahren in Teilen schon auch überholt. Ganz allein auf weiter Flur stand es schon damals nicht. Ein Jahr später ist Richard Cannings „Gay Fiction Speaks“ erschienen, zum Teil mit denselben Autoren in den Interviews. Philip Gambone hatte so eine Art Fahrplan für seine Gespräche, an den er sich mal mehr, mal weniger hält. So kommt es, dass er viele Partner auf die Überraschungserfolge des Jahres 1978 anspricht, „Faggots“ (Schwuchteln) von Larry Kramer, „Dancer from the Dance“ (Tänzer der Nacht) von Andrew Holleran, beide auch auf Deutsch erhältlich, bei uns aber niemals in dem Maß als Urknall neuerer Schwulenliteratur wahrgenommen oder eingeordnet, wie Gambone es hier tut. „Wie hast du damals gelebt? Hast du das mitgekriegt? Hat es dich beeinflusst?“ Wieder und wieder wundert er sich, in welch erstaunlichem Umfang die Formen, Formate und Verkaufszahlen schwuler Texte seit 1978 in den USA zugenommen haben und äußert schon auch gewisse Zweifel, ob es besser denn noch werden kann. Von einer goldenen Zeit des schwulen US-Romans zwischen 1978 und 1998 wissen wir heute natürlich nichts. Die Buchhändler beteuern nach wie vor: „Das Beste ist neulich erst erschienen!“ (Und folglich nicht in diesem Buch und sein Autor wohl ebenfalls nicht.)
Drei von Gambones Gesprächspartnern waren bei Erscheinen der Interviewsammlung wegen Aids verstorben: Allen Barnett, John Preston und Paul Monette. Gender-Themen wie das Aufwachsen als Transfrau oder Transmann kommen überhaupt noch nicht vor.
Philip Gambone war Dozent an der Universität in Boston und hatte die Interviews als Gründer einer der ersten US-Schwulenzeitschriften schon in den frühen Achtzigern in die Wege geleitet. Dann wurde daraus eine Serie von Werkstattgesprächen fürs Radio. Als es über 30 waren, sei es Zeit für ein Buch gewesen. Damit ist eine gewisse Schwachstelle dieser Sammlung umrissen: Bei Entstehungsdaten von 1987 bis 1998 zwingt das Buch dann doch disparate Epochen zusammen und erwischt gewisse Autoren einfach im falschen Jahr.
Der Verweis auf 1978 als Jahr des Urknalls und – in der Person von Andrew Holleran – auf die New Yorker Autorengruppe „Violet Quill“, die allerdings Edmund White als durchaus nicht so fulminant beschreibt (in etwa: „Na ja, da rief jeder jemanden an, den er kannte, wir mochten es, weil wir die Wohnungen der anderen mal von innen sehen konnten, dann lasen wir uns was vor, dann zerfiel das gleich wieder“) geht damit einher, dass Philip Gambone hier die Schreiber seiner eigenen Generation, quasi die „Klasse von 1978“, um sich versammelt. Fast alle Geburtsjahre liegen zwischen 1940 und 1963 und Gambone ist Jahrgang 1948. Das sind inzwischen also Sechzig- bis Achtzigjährige, mit anderen Worten nicht mehr die schwule Literatur von heute. Seinerzeit war es ihm gelungen, die allermeisten wirklich wichtigen Schreiber der Szene entweder bei ihrem Schwanengesang oder schon bei den ersten Erfolgen zu erwischen.
Aber das Jahr passte nicht immer. Michael Cunninghams bekanntester Roman „Die Stunden“ war noch nicht erschienen, darum wird über sein erstes Buch „Ein Zuhause am Ende der Welt“ geredet. Und der einst so gefeierte Autor David Leavitt ist heute fast Schnee von gestern. „Die Schwimmbad-Bibliothek“ von Alan Hollinghurst hatte es gegeben, aber geredet wird über Hollinghursts zweites Buch, „Der Hirtenstern“, das zumindest das deutsche Publikum wesentlich später und nur in einem schwulen Spartenverlag erreicht hat (die Schwimmbad-Bibliothek dagegen als Fischer-Taschenbuch). Dass es vom da schon verstorbenen Allen Barnett nur ein einziges Buch zu kaufen gab, das Gambone dann epochal nennt, war klar. Nur hat diese Werkgeschichte dem Renommee dieses Autors in Mitteleuropa nicht gerade aufgeholfen.
Während ein paar alte Helden in ihren herbstlichen Jahren noch einmal aufdrehten, zumindest seitenmäßig, Edmund White, David Plante, der Chronist frankoamerikanischer Familien, ein Unbekannter in Deutschland, Peter Cameron, Dennis Cooper, der Krimiautor Michael Nava, Lev Raphael, der sich ab ungefähr hier auf Krimis verlegt hat, die nicht ins Deutsche übersetzt werden, sind andere Karrieren mehr oder weniger versandet und vergessen worden. Paul Monette starb an Aids, hinterließ seine Memoiren „Coming-out“, von denen man sich in Deutschland viel erhoffte, die dann aber verramscht wurden. Brad Gooch, der vorher als Model gearbeitet hatte, war immer noch so fotogen, dass er zum Coverboy für dieses Buch wurde, kommt seit „Mailand – Manhattan“ aber im deutschen Markt nicht mehr vor. Und das sind jetzt über 30 Jahre. (In den USA hat er auf Spirituelles und Ratgeberbücher umgeschwenkt.)
Besonders viel Hoffnung scheint Philip Gambone in die ganz Jungen unter 30 gesetzt zu haben. Aber es kommt anders, als man denkt. Scott Heims „Mysterious Skin“, Roman einer Horror-Jugend im ländlichen Kansas, wird zum Smash Hit, kam auch in Deutschland an, aber der Autor ist bei uns längst vergessen. Heims Freund, der Bostoner Michael Lowenthal, der über ihr privates Zusammenleben nicht sprechen möchte, hat auch nicht mehr oft publiziert und ist in Deutschland nach wie vor unbekannt. Ähnliches gilt für Brian Keith Jackson, der schwule Themen weitgehend weggeblendet hat, aber mit einem Buch über seine Mutter und andere Schwarze in Harlem zu großem Erfolg in den USA gekommen ist.
Erstaunlicherweise hat ein mittlerweile zum lebenden Klassiker aufgestiegener Violet-Quill-Autor wie Andrew Holleran sein gesamtes Schriftstellerleben unter einem Pseudonym verbracht, das er seinen unmittelbaren alltäglichen Kontakten konstant vorenthalten hat. Erst seitdem die (langlebige) Mutter tot ist und jeder schnell ins Internet schauen kann, weiß „die Welt“, dass er im Süden der USA Eric Garber hieß, im schwulen New Yorker Verlag aber Holleran. Seine Bücher sind oft autobiografisch, doch heißt dort der Erzähler noch mal anders. Man muss allerdings sehen – er sagt es auch -, dass dieser Schreiber als Holleran sich über Jahrzehnte eine Karriere als Zeitschriftenautor und Dozent für kreatives Schreiben hat aufbauen können, wie das in derselben Zeit für einen homosexuellen Schreiber deutscher Zunge überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. (Friedrich Kröhnke und Detlev Meyer am Leipziger oder Bieler Literaturinstitut, als Akzente-, Merkur- oder Merian-Autoren?)
Dreamland herrscht jenseits des Atlantiks aber auch nicht. Einer der Autoren sagt, mit seinem ersten Roman habe er wohl 500 Dollar verdient. Einer sagt, jeden Roman, den er publizierte, habe er vorher sechs oder sieben Mal geschrieben. Er lege großen Wert darauf, an jeder einzelnen Stelle seiner Texte das optimale Wort stehen zu sehen. Dass die meisten im Publikum dies wahrscheinlich nie bemerkten, helfe ihm nicht weiter. Joseph Hansen, obwohl seit Jahrzehnten erfolgreicher Krimischreiber, dessen Paperbacks in Bahnhöfen und Flugplätzen an die Krimikäuferin gebracht wurden, sagt, er hätte gerne viel mehr Nicht-Krimi-Bücher ausprobiert, doch müsste er, bevor er sich auf dergleichen einlasse, die wirtschaftliche Gewissheit haben, auch nach zwei Jahren von jetzt an noch genügend Einnahmen zu generieren, um halbwegs angenehm leben zu können. (Er war, wie man aus den Brandstetter-Krimis ja weiß, ein Genießer und Kenner, außerdem, wie er im Interview allerdings nicht offenbart, mit einer Frau verheiratet.)
Autoren wie Allen Barnett oder Bernard Cooper sind schon mehrere Jahre vor ihrem ersten Buch „berühmt“ gewesen, weil sie sich durch ein Netzwerk aus Creative-Writing-Seminaren, literarischen Auszeichnungen, Buchbesprechungen über Werke von Kollegen, allerlei Storys in Zeitschriften immer weiter entwickeln konnten. Mehrere waren sich schon als Schüler sicher, sie werden vom Schreiben leben. Einer dieser Autoren, darauf angesprochen, dass er viele journalistische Artikel veröffentlicht, meint, ja, dabei habe ich das nie gelernt, nicht Journalismus, kreatives Schreiben habe ich studiert.
Alle werden nach Arbeitsgewohnheiten befragt und um Ratschläge für junge Autoren gebeten. Die Antworten sind nüchtern, pragmatisch, aber auch selbstbewusst. Träum keinen Tag länger, sondern tu es! Lass dir von niemand irgendwas sagen! Glaub deinem inneren Kompass! Wer sich einen Leserkreis vorstellt und für ihn schreibt, wird Flops produzieren! Immer wieder liest man, dass sie wirklich jeden Tag etwas arbeiten. Allerdings die meiste Zeit nicht für das Neuschreiben von Text, für das Erschaffen, sondern viel mehr für das Noch-mal-Schreiben, das Kürzen, das Überarbeiten, das Kontrollieren. Einer erzählt, lange hätte er einen separaten, abschließbaren Arbeitsraum ohne Telefon gehabt, den er jeden Morgen wie einen Fabrik aufgesucht habe. Andrew Holleran, der ein Buch über einen älter gewordenen Schwulen geschrieben hat, der in Floridas Cruising Areas versucht, immer noch attraktiv zu bleiben, behauptet, mit einem einzelnen Menschen hätte er sich nie fürs Leben verbinden können, weil er mit dem Schreiben diese Bindung bereits eingegangen war. (Man muss allerdings sagen, an der einen oder anderen Stelle seines Werks liest es sich auch so, als habe er diesen Mann nie bekommen können, weil er schon mit seiner Mutter verheiratet war.)
Aids als Thema war eine professionelle Zumutung für die Meisten. Andrew Holleran sagt, man kann nicht wirklich über Aids schreiben. Man kann aber auch nicht länger über Aids nicht schreiben. Es ist zu groß und ist überall. David Leavitt sagt, ständig übt man Druck auf mich aus, einer wie ich sollte endlich das Aids-Buch schreiben. Weder künstlerisch noch als Argument finde ich das überzeugend und für mich, angesichts meiner persönlichen Entwicklung, nicht förderlich. Eigentlich ist es eine unverschämte Forderung. In den neuesten Gesprächen von Gambones Buch kommt allerdings die Vermutung auf, Aids sei als schwuler Buchgegenstand mittlerweile fast schon durch und abgegrast.
Nicht ganz zu Unrecht mutmaßen einige, das nächste Ding könnten homosexuelle Eltern sein, Patchwork-Familien, queere Familien aus vordem Diskriminierten. Außerdem wird bemerkt, dass es einen Konflikt bezüglich der ökonomischen Grundlagen der schwulen Autorenexistenz immer geben werde. Viele Leser, vor allem wenn sie fast nur in schwulen sozialen Bezügen existieren, dürsten nach explizitem Sex, dagegen vermittelt das Feedback heterosexueller Buchkäuferinnen, namentlich der Frauen, dass irgendwo eine Grenzlinie ist, jenseits derer man den Autor dann nicht mehr kauft. Oder, wie Hansen sagt: „Nur von meinen Schwulen hätte ich doch nie leben können. Ich war immer auf den normalen Krimimarkt angewiesen.“ (Und ein Cameron oder ein Cunningham auf die Leserin, die sich an den Rezensenten der FAZ oder Zeit oder des Deutschlandfunks orientiert.)
Ein paar Mal im Buch kommt auch noch eine Stelle vorbei wie: „Das ging um einen Schwulen, bei dem es nicht mehr lief, weil der älter wurde. Ein noch ganz selten bearbeitetes Thema.“ Das ist wohl so geblieben. Dieses schwule Thema scheint noch offen zu sein.