Osteuropa-Literatur discussion
Dostojewski "Böse Geister"
>
Abschnitt 9
date newest »
newest »
 newest »
newest »
 Nun kommt langsam Licht ins Dunkel und man erfährt, was Schatows Rolle mit Blick auf den Nihilismus/ Sozialismus ist. Klar wird auch Kirillows (künftige) Rolle und man ahnt, wozu Fedka in dessen Wohnung "aufgespart" wird. Dass Peter/ Piotr ein ziemlich fieses doppeltes Intrigenspiel spielt, zeichnet sich bereits zu Anfang ab und gewinnt dann zunehmend an Kontur. Er hat die Fäden in der Hand. Unklar bleibt lediglich Stawrogins Rolle. Einerseits scheint er über allem zu schweben, andererseits will sich Peter seiner entledigen. Wird das gelingen? Und wozu soll Schatow aufgespart werden? Das sind wieder so Fragen. Die Frauen werden dieses Mal allerdings ziemlich übergangen. Allenfalls kann nun als sicher gelten, dass Lisaweta Stawrogin liebt. Hm, wozu ist der aber verheiratet? - Da bleibt die Spannung also erhalten. Literarisch ist das gut gemacht. Dostojewskis Bild von den Revolutionären seiner Zeit (Herzen) scheint allerdings ein bisschen primitiv. Ich denke, er trennt den Nihilismus/ Anarchismus (die Ideologie der arroganten und gottlosen Führer) vom Sozialismus als der Ideologie des "Materials", also der Menschen, die wohl mitmachen, aber zu keinen eigenen Gedanken fähig sind, und schmeißt sie dann beide in einen Topf, um das entstehende Gebräu abscheulich zu finden. Zu Recht: Dass "einfache Leute" von Berufsrevolutionären als "Material" benutzt und betrachtet werden, verweist auf unglaublich geniale Weise auf die Zukunft und macht mithin deutlich, aus welcher "Schule" Lenin und seine Mitstreiter kamen. Lenins Bruder war ja verurteilter Zaren- Attentäter und diese Ereignisse haben auf den jungen Uljanow stark gewirkt. Ohne dass er das als Autor wirklich weiß, schafft es Dostojewskis geniale künstlerische Begabung in der Beobachtung und Schilderung politischer Vorgänge seiner Zeit, deren Grundproblem aufzuzeigen: Die ausgefallene Aufklärung (=Volksbildung) machte die Kluft zwischen den intellektuellen und im Westen gebildeten Führern und dem also von ihnen zu führenden "Volk" (hier vor allem kleinbürgerlich- verbeamtete Elemente) unüberbrückbar. Es bedurfte des Krieges, um mit Hilfe der Friedenssehnsucht für kurze Zeit eine echte Interessenübereinstimmung und also massenhafte Zustimmung zur gewaltsamen Veränderung der Zustände zu erringen. Mag sein, dass die Erfahrung der eigenen Resonanzlosigkeit im Volk, das gerne alle diejenigen denunzierte, die sich an "Väterchen Zar" versündigen wollten, Stalin zu seinem abgrundtiefen Misstrauen gebracht hat. Das ist Spekulation, zeigt aber, dass Dostojewski bei aller scheinbaren Naivität und seinem Unverständnis gegenüber sozialistischen Ideen durchaus gut beobachtet und dargestellt hat, worin deren Schwächen in Russland bestanden. Das gilt natürlich vor allem auch für den Umgang mit dem Problemfeld "Volksreligiosität", für das die materialistisch- atheistisch eingestellten Nihilisten/ Anarchisten/ Sozialisten keine Lösungen hatten...
Nun kommt langsam Licht ins Dunkel und man erfährt, was Schatows Rolle mit Blick auf den Nihilismus/ Sozialismus ist. Klar wird auch Kirillows (künftige) Rolle und man ahnt, wozu Fedka in dessen Wohnung "aufgespart" wird. Dass Peter/ Piotr ein ziemlich fieses doppeltes Intrigenspiel spielt, zeichnet sich bereits zu Anfang ab und gewinnt dann zunehmend an Kontur. Er hat die Fäden in der Hand. Unklar bleibt lediglich Stawrogins Rolle. Einerseits scheint er über allem zu schweben, andererseits will sich Peter seiner entledigen. Wird das gelingen? Und wozu soll Schatow aufgespart werden? Das sind wieder so Fragen. Die Frauen werden dieses Mal allerdings ziemlich übergangen. Allenfalls kann nun als sicher gelten, dass Lisaweta Stawrogin liebt. Hm, wozu ist der aber verheiratet? - Da bleibt die Spannung also erhalten. Literarisch ist das gut gemacht. Dostojewskis Bild von den Revolutionären seiner Zeit (Herzen) scheint allerdings ein bisschen primitiv. Ich denke, er trennt den Nihilismus/ Anarchismus (die Ideologie der arroganten und gottlosen Führer) vom Sozialismus als der Ideologie des "Materials", also der Menschen, die wohl mitmachen, aber zu keinen eigenen Gedanken fähig sind, und schmeißt sie dann beide in einen Topf, um das entstehende Gebräu abscheulich zu finden. Zu Recht: Dass "einfache Leute" von Berufsrevolutionären als "Material" benutzt und betrachtet werden, verweist auf unglaublich geniale Weise auf die Zukunft und macht mithin deutlich, aus welcher "Schule" Lenin und seine Mitstreiter kamen. Lenins Bruder war ja verurteilter Zaren- Attentäter und diese Ereignisse haben auf den jungen Uljanow stark gewirkt. Ohne dass er das als Autor wirklich weiß, schafft es Dostojewskis geniale künstlerische Begabung in der Beobachtung und Schilderung politischer Vorgänge seiner Zeit, deren Grundproblem aufzuzeigen: Die ausgefallene Aufklärung (=Volksbildung) machte die Kluft zwischen den intellektuellen und im Westen gebildeten Führern und dem also von ihnen zu führenden "Volk" (hier vor allem kleinbürgerlich- verbeamtete Elemente) unüberbrückbar. Es bedurfte des Krieges, um mit Hilfe der Friedenssehnsucht für kurze Zeit eine echte Interessenübereinstimmung und also massenhafte Zustimmung zur gewaltsamen Veränderung der Zustände zu erringen. Mag sein, dass die Erfahrung der eigenen Resonanzlosigkeit im Volk, das gerne alle diejenigen denunzierte, die sich an "Väterchen Zar" versündigen wollten, Stalin zu seinem abgrundtiefen Misstrauen gebracht hat. Das ist Spekulation, zeigt aber, dass Dostojewski bei aller scheinbaren Naivität und seinem Unverständnis gegenüber sozialistischen Ideen durchaus gut beobachtet und dargestellt hat, worin deren Schwächen in Russland bestanden. Das gilt natürlich vor allem auch für den Umgang mit dem Problemfeld "Volksreligiosität", für das die materialistisch- atheistisch eingestellten Nihilisten/ Anarchisten/ Sozialisten keine Lösungen hatten...
 Man merkt halt, dass weder Hollywood noch Netflix das Recht spannende "Serien" erfunden zu haben für sich beanspruchen dürfen. Umgekehrt sieht man an der Karriere der "Technik", wie modern Dostojewski war, der freilich bei den Engländern (Walter Scott, Waverley, 1814), Amerikanern (Cooper, Lederstrumpf, 1820er) und Franzosen (Balzac, Verlorene Illusionen, 1830er/40er) insofern Vorbilder finden konnte, als die das Prinzip in all ihren Romanen wiederkehrende Personen vorzuführen, "erfunden" hatten. Einen ganzen Roman aus "Episoden" zu konstruieren, die über Cliffhanger miteinander verbunden wurden, folgt natürlich der "Logik" des Fortsetzungsromans, wie er in der Nachfolge von Eugène Sue (Die Geheimisse von Paris, 1840er) die europäischen Feuilletons beherrschte. Von hier führt der Weg geradewegs zum Fernsehfilm, der schon sehr früh das Prinzip der "Serie" übernahm. Interessant an Dostojewski, aber auch Tolstoi z.B., ist, dass sie zwar einem Prinzip folgten, das potentiell zur Trivialität neigt (ich schiebe halt einem Erfolgsroman einen im Strickmuster gleichen zweiten nach - Vater und Sohn Dumas in den 1840ern!), dabei aber die darin liegenden Gefahren souverän umschifften. Ob das eine Leistung ist? Klar doch. So viele gelungene Beispiele gibt es dafür nicht; Gegenbeispiele aber die Menge...
Man merkt halt, dass weder Hollywood noch Netflix das Recht spannende "Serien" erfunden zu haben für sich beanspruchen dürfen. Umgekehrt sieht man an der Karriere der "Technik", wie modern Dostojewski war, der freilich bei den Engländern (Walter Scott, Waverley, 1814), Amerikanern (Cooper, Lederstrumpf, 1820er) und Franzosen (Balzac, Verlorene Illusionen, 1830er/40er) insofern Vorbilder finden konnte, als die das Prinzip in all ihren Romanen wiederkehrende Personen vorzuführen, "erfunden" hatten. Einen ganzen Roman aus "Episoden" zu konstruieren, die über Cliffhanger miteinander verbunden wurden, folgt natürlich der "Logik" des Fortsetzungsromans, wie er in der Nachfolge von Eugène Sue (Die Geheimisse von Paris, 1840er) die europäischen Feuilletons beherrschte. Von hier führt der Weg geradewegs zum Fernsehfilm, der schon sehr früh das Prinzip der "Serie" übernahm. Interessant an Dostojewski, aber auch Tolstoi z.B., ist, dass sie zwar einem Prinzip folgten, das potentiell zur Trivialität neigt (ich schiebe halt einem Erfolgsroman einen im Strickmuster gleichen zweiten nach - Vater und Sohn Dumas in den 1840ern!), dabei aber die darin liegenden Gefahren souverän umschifften. Ob das eine Leistung ist? Klar doch. So viele gelungene Beispiele gibt es dafür nicht; Gegenbeispiele aber die Menge...
 Also, ich habe irgendwie den Eindruck, in diesem Abschnitt kommt überhaupt niemand wirklich gut weg... ich hab das darauf zurückgeführt, dass wir alle Figuren aus der Perspektive von Pjotr sehen und er einfach unglaublich arrogant und überheblich ist.
Also, ich habe irgendwie den Eindruck, in diesem Abschnitt kommt überhaupt niemand wirklich gut weg... ich hab das darauf zurückgeführt, dass wir alle Figuren aus der Perspektive von Pjotr sehen und er einfach unglaublich arrogant und überheblich ist. Ich vermute außerdem, ich bin für den Nihilismus nicht gemacht - wenn Dostojewskij eines schafft, dann seine eigene Ablehnung auf mich zu übertragen... ich hab ja grundsätzlich nichts gegen Widerstand, Rebellion oder dem Bedürfnis nach einer Änderung der Verhältnisse. Aber irgendwie fehlt mir bei Pjotr der Wert bzw. das Ideal für das er das tut, was er tut. Mir ist er glaube ich einfach zu destruktiv. Und ich finde Menschen einfach furchtbar, die ihre Überlegenheit anderen gegenüber ausnutzen und sich dann noch darüber lustig machen... also Freunde würden wir nicht, der Pjotr und ich. ;) Aber mir ist schon klar, dass er halt so sein muss, um Dostojewskijs Intention umzusetzen... aufregen tut er mich trotzdem. :D
 Die Figur Pjotr Stepanowitsch empfinde ich als sehr realitätsnah. Wir wissen, dass er ohne Mutter und Vater ausgewachsen ist. Mittlerweile gibt es genug psychologisches Wissen, um zu erkennen, welche Auswirkungen es hat, wenn Bezugspersonen fehlen, auf die man sich verlassen kann und wenn ein Kind in der frühen Kindheit nicht genug Liebe und Zuwendung erfährt. Daraus kann ein Erwachsener werden, der kein Vertrauen in sich und seine Zukunft hat, alles ablehnt und sehr destruktiv handelt. Genau das hat Dostojewski beobachtet und hier beschrieben. Dazu kommt, dass Pjotr nicht dumm ist, er durchschaut die Situation und die Personen um ihn herum gut und spielt sie entsprechend aus. Aber, und das finde ich auch typisch, er hat außer persönlichen Rachegefühlen und einer empundenen Ungerechtigkeit kein wirkliches Ziel. Die ihm zugefügten Ungerechtigkeiten lassen sich nicht mit Kampf oder Revolution ausgleichen. Bisher war auch nichts davon zu lesen, dass er sich für andere einsetzen möchte. Andere erscheinen ihm als "Material", aber nicht als Mitmenschen.
Die Figur Pjotr Stepanowitsch empfinde ich als sehr realitätsnah. Wir wissen, dass er ohne Mutter und Vater ausgewachsen ist. Mittlerweile gibt es genug psychologisches Wissen, um zu erkennen, welche Auswirkungen es hat, wenn Bezugspersonen fehlen, auf die man sich verlassen kann und wenn ein Kind in der frühen Kindheit nicht genug Liebe und Zuwendung erfährt. Daraus kann ein Erwachsener werden, der kein Vertrauen in sich und seine Zukunft hat, alles ablehnt und sehr destruktiv handelt. Genau das hat Dostojewski beobachtet und hier beschrieben. Dazu kommt, dass Pjotr nicht dumm ist, er durchschaut die Situation und die Personen um ihn herum gut und spielt sie entsprechend aus. Aber, und das finde ich auch typisch, er hat außer persönlichen Rachegefühlen und einer empundenen Ungerechtigkeit kein wirkliches Ziel. Die ihm zugefügten Ungerechtigkeiten lassen sich nicht mit Kampf oder Revolution ausgleichen. Bisher war auch nichts davon zu lesen, dass er sich für andere einsetzen möchte. Andere erscheinen ihm als "Material", aber nicht als Mitmenschen. Man sieht das heute mit Blick in die Zukunft, die Revolution und dann Stalin, aber das konnte Dostojewski eigentlich nicht voraussehen. Er hat die damalige Situation beschrieben und seine Abneigung gegen Menschen zum Ausdruck gebracht, die anarchistische und damit destruktive Ideen verfolgten. ich bin mir sicher, dass es genau solche Typen gegeben hat.
Jetzt verstehe ich auch, warum Schatow nicht auf das Projekt einer Druckerei mit Lisa eingehen konnte.
Die Beschreibung der Schpigulinschen Fabrik ist wirklich stark. Ich finde, es gibt zu selten Personen in D. Büchern, die täglich einer Arbeit nachgehen. Einige sind mit der Verwaltung ihrer Güter beschäftigt, einige Offiziere oder Offiziere a. D., aber sonst? Oder habe ich das überlesen?
 Babette wrote: "Die Figur Pjotr Stepanowitsch empfinde ich als sehr realitätsnah. Wir wissen, dass er ohne Mutter und Vater ausgewachsen ist. Mittlerweile gibt es genug psychologisches Wissen, um zu erkennen, welc..."
Babette wrote: "Die Figur Pjotr Stepanowitsch empfinde ich als sehr realitätsnah. Wir wissen, dass er ohne Mutter und Vater ausgewachsen ist. Mittlerweile gibt es genug psychologisches Wissen, um zu erkennen, welc..."Freilich sehen wir mehr als der Autor und Dostojewski konnte nicht wissen, was wir in seine Texte hinein lesen. Aber das Geheimnis großer Literatur ist ja, dass es da etwas geben muss, weswegen wir etwas hinein lesen können. Wir müssen da etwas finden, was anschlussfähig ist und eben das hat der Autor geschrieben. Es erscheint uns womöglich in einem anderen Licht als ihm, aber es ist doch da. In einem anderen Kontext, der auch Interpretation ist, nannte (nennt?) man das Prophetie. ;-) Offensichtlich gibt es Menschen, die beim Beobachten der menschlichen Verhältnisse in diesen Verhältnissen aufnehmen, was da untergründig und inwendig in einer Weise mitschwingt, die erst künftig zum Tragen kommt. Woran mag Goethe im "Zauberlehrling" gedacht haben? Meine Schüler/innen in Kiew dachten sofort an Tschernobyl und damit war Goethe "aktuell", ohne dass er es hätte sein dürfen. In gleicher Weise können wir Schillers "Karl Moor" als Gleichnis auf den Terrorismus lesen und erschüttert über dessen "Aktualität" sein. Lesen wir hingegen die Schiller- Bearbeitung von Goethes Schwager Vulpius, die als "Der edle Räuber Rinaldo Rinaldini" ein zeitgenössischer Erfolg war, der alles von Goethe und Schiller Verfasste in den Schatten stellte, so werden wir heute darin NICHTS finden außer einer öden Trivial- Story, die bestenfalls noch als Kindermärchen durchgehen könnte. (Ok, ich denke noch in den Zeiten, als Horrorfilme noch keinen Einzug ins Kinderzimmer gehalten hatten!) Also gab es bei Schiller eine "zeitlose (?) Wahrheit", die anschlussfähig ist, und bei Vulpius gab es die nicht. In diesem Sinne ist Dostojewski "groß", denn wir lesen seinen Text und können dabei an Stalin denken und Folgen eines Denkens sehen, das Dostojewski uns eindringlich schildert. Ich fand z.B. auch schön, wie im folgenden Kapitel ;-) Schigalew über "Sozialismus" spricht: "Indem ich von unbeschränkter Freiheit ausgehe, schließe ich mit unbeschränktem Despotismus. Ich füge jedoch hinzu, daß es außer meiner Lösung des sozialistischen Problems keine andere geben kann.« Da lacht sich doch der Fuchs ins Fäustchen! ;-) - Deine Beobachtung, was das arbeitende Volk anbelangt, ist wohl richtig. Bestenfalls kommen Studenten oder Prostituierte (Sonja in "Schuld und Sühne") vor. Aber wie sollte es anders sein? In der streng hierarchischen Gesellschaft waren Arbeiter und sogar Kleinbürger nicht des Autors Umgang; Tolstoi kannte wenigstens Bauern aus dem Krieg und dann aus seinen sozialutopischen Projekten. Anders als Tolstoi sieht Dostojewski das "Volk" nur abstrakt und wenn schon, dann entweder als Träger christlicher Heilserwartung (Utopien, die an den Armen gebunden sind), oder als notorische Säufer und Bösewichter. Deswegen konnte er den Ideen des Sozialismus auch nichts abgewinnen, denn dafür hätte er im Volk ganz konkret eine verändernde Kraft sehen müssen. Dafür hat er aber nur das Bild der Heugabel als Symbol der Zerstörung, womit er Recht hatte, denn der russische Bauer war aus seiner Lage heraus gewiss kein "revolutionäres Potential", womit er den Nihilisten (wie Stalin!) notwendig (?) - aber jedenfalls doch mit einer gewissen Logik - zum bloßen "Material" eines abstrakten Fortschritts werden musste...
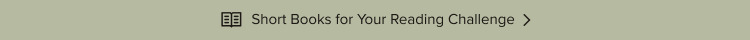


(S. 510) bis ca. 5.11.